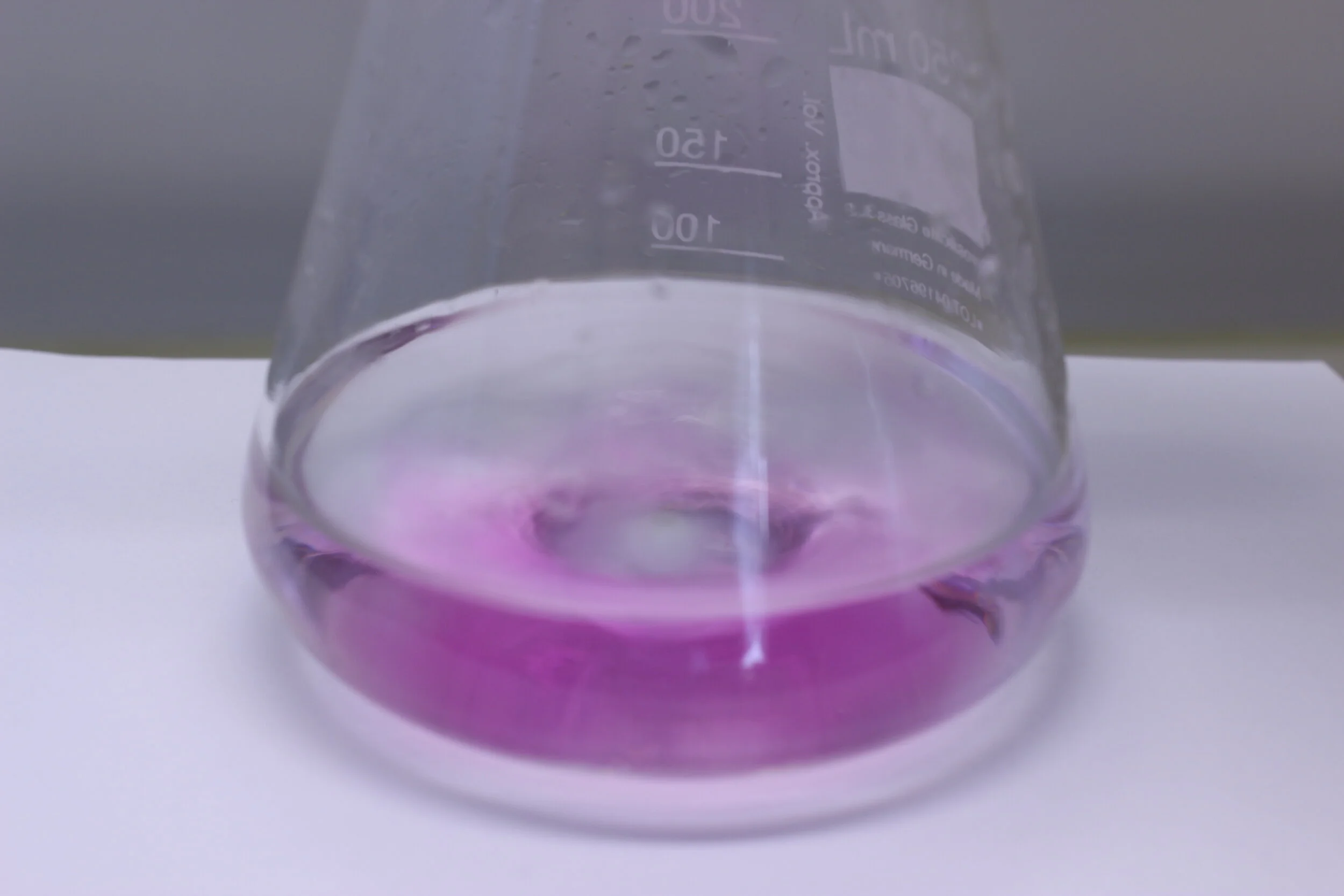Schwefelsäure und Zucker
Konzentrierte Schwefelsäure ist eine starke Säure, die besonders gut mit organischen Materialien reagiert und stark hygroskopisch wirkt. Beim Experiment "Schwefelsäure + Zucker" wird genau dieser Sachverhalt untersucht.
Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!
Einleitung
Konzentrierte Schwefelsäure ist eine starke Säure, die besonders gut mit organischen Materialien reagiert und stark hygroskopisch wirkt. Beim Experiment "Schwefelsäure + Zucker" wird genau dieser Sachverhalt untersucht.
Schwierigkeitsgrad
Demonstrationsexperiment - mittel
Geräte
Becherglas 400 mL, Becherglas 50 mL, Messzylinder, Glasstab, säurefeste Handschuhe, Schutzbrille
Chemikalien
konz. 96% Schwefelsäure
Zucker (Saccharose)
Hinweis
Durchführung im Abzug!
Durchführung
In ein 400 mL Becherglas werden 70 g Zucker vorgelegt, mit 10 mL Wasser befeuchtet und mittels Glasstab umgerüht.
Anschließend werden mit einem Messzylinder 50 mL konz. Schwefelsäure hinzugegeben und zugig mit dem Glasstab erneut umgerüht.
Entsorgung
Nach Ende und Abkühlen der Reaktion wird das Produkt mit einer Lauge (z.B. Natriumcarbonat) neutralisiert und gefiltert. Feste Rückstände können im Abfall, flüssige Rückstände im Ausguss entsorgt werden.
Erklärung
Die konzentrierte Schwefelsäure reagiert unter Gasbildung immer schneller mit dem angefeuchteten Zucker. Im Laufe der Zeit bildet sich eine "Kohlenstoff-Schlange" aus, die langsam nach oben wächst.
Konzentrierte Schwefelsäure ist neben ihrer starken Säurewirkung auch stark hygroskopisch (=Wasseranziehend). Formal "zieht" die Schwefelsäure in diesem Versuch das Wasser aus den Zuckermolekülen:
Diese Tatsache führte historisch auch zur Bezeichnung "Kohle(n)hydrate" - welche jedoch eigentlich bei genauerer Betrachtung nicht korrekt ist. Tatsächlich kommt es allerdings zu Redox-Reaktionen der Kohlenstoff-Atome des Zuckers, wobei schweflige Säure und Kohlenstoffdioxid entstehen:
Die schweflige Säure zerfällt ihrerseits in Schwefeldioxid und Wasser:
Die entstehenden Gase Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid treiben die Masse in die Höhe. Auf einem ähnlichen Prinzip basiert auch das Experiment der Schlange des Pharao.
Video
Literatur
Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)
Saccharose (Kein Gefahrstoff nach GHS)
Werbung
Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.
Titration von Essig
In einem bereits veröffentlichten Experiment wurde das Messen von Titrationskurven mit einem pH-Meter beschrieben und unter anderem den Äquivalenzpunkt bestimmt. An diesem Punkt ist die Stoffmenge der zugetropften Maßlösung, gleich der Stoffmenge des Analyten. Bei bekannter Konzentration der Maßlösung und dem Wissen über die Volumina der Maßlösung und des Analyten, lässt sich im Umkehrschluss also die Konzentration von letzterem ermitteln.
Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!
Einleitung
In einem bereits veröffentlichten Experiment wurde das Messen von Titrationskurven mit einem pH-Meter beschrieben und unter anderem den Äquivalenzpunkt bestimmt (hier). An diesem Punkt ist die Stoffmenge der zugetropften Maßlösung, gleich der Stoffmenge des Analyten. Bei bekannter Konzentration der Maßlösung und dem Wissen über die Volumina der Maßlösung und des Analyten, lässt sich im Umkehrschluss also die Konzentration von letzterem ermitteln.
Schwierigkeitsgrad
Schülerexperiment - einfach
Geräte
Bürette, Stativmaterial, Magnetrührer mit Rührfisch, 5 Erlenmeyerkolben, Messkolben, Messzylinder, Analysenwaage, Trichter, Filterpapier, 10 mL Vollpipette, 5 mL Vollpipette, Aräometer
Chemikalien
Natiumhydroxid-Maßlösung (c = 0,1 mol/l)
Apfelessig 5%
Phenolphthalein-Lösung 0,1% (ethanolisch)
Aktivkohle
Durchführung
Vorbereitung
75 mL Apfelessig werden in einem kleinen Erlenmeyerkolben zur Entfernung der bräunlichen Farbe mit 0,25 g Aktivkohle versetzt. Die Aktivkohle wird durch anschließende Filtration entfernt und 10,0 mL des nun farblosen Filtrats in einem Messkolben auf 100,0 mL verdünnt.
In drei Erlenmeyerkolben werden je 5,0 mL der verdünnten Essigsäure mit 50 mL dest. Wasser und wenigen Tropfen 0,1% ethanolischer Phenolphthalein-Lösung versetzt.
Unter magnetischem Rühren wird drei Mal mit 0,1 M Natronlauge titriert und das Volumen an verbrauchter Maßlösung bis zum Umschlagspunkt des Indikators notiert:
1) 4,6 mL
2) 4,7 mL
3) 4,7 mL
Über die Formel wird die Konzentration der Säure ausgerechnet:
Wobei sich unter Berücksichtigung der vorhergehenden Verdünnung folgende Konzentration an Essigsäure im Essig ergibt: 0,93 mol/L
Mit folgenden Formeln wird der Massenanteil in Prozent berechnet, wobei dafür die Dichte des Essigs mittels Aräometer bestimmt werden muss:
β / ρ = w
0,93 mol/L entsprechen bei einer Dichte von 1,0094 g/cm3 ungefähr 5,5%.
Entsorgung
Alle Lösungen können neutral dem Abwasser zugeführt werden.
Erklärung
Natronlauge neutralisiert Essigsäure, wobei Natriumacetat (und Wasser) entsteht:
Für ein Mol Essigsäure, wird zur vollständigen Neutralisation exakt ein Mol Natriumhydroxid. Über das Volumen der Essigsäure und das Volumen der verbrauchten Maßlösung bekannter Konzentration, lässt sich die Konzentration der Essigsäure berechnen. Als Indikator sollte Phenolphthalein verwendet werden, da der Äquivalenzpunkt (hier beschrieben) nicht bei pH 7 liegt.
Foto
Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)
Aktivkohle (kein Gefahrstoff nach GHS)
Essig (kein Gefahrstoff nach GHS)
Werbung
Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.
Wasser auf Schwefelsäure
Den Leitsatz »Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!« bekommt beinahe jeder Schüler im Chemieunterricht zu Ohren. In diesem Experiment missachten wir - unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsvorkehrungen - bewusst dieses Grundprinzip und sehen was passiert.
Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!
Einleitung
Den Leitsatz »Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!« bekommt beinahe jeder Schüler im Chemieunterricht zu Ohren. In diesem Experiment missachten wir - unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsvorkehrungen - bewusst dieses Grundprinzip und sehen was passiert.
Schwierigkeitsgrad
Demonstrationsexperiment - mittel
Geräte
Messzylinder 1000mL, säurefeste Handschuhe, Schutzbrille, Tropfpipette, Uhrglasschale
Chemikalien
konz. 96% Schwefelsäure
Natriumcarbonat
Durchführung
In einen sehr hohen Messzylinder wird bodenbedeckt (20 mL) konz. Schwefelsäure vorgelegt. Der Messzylinder wird mit einer Uhrglasschale bedeckt, um mögliche Säurespritzer abzufangen. Über den kleinen Spalt, zwischen Schnabel des Zylinders und Uhrglasschale, wird mit der Tropfpipette vorsichtig Wasser auf die Schwefelsäure getropft.
Entsorgung
Lösung großzügig mit Wasser verdünnen, mit Natriumcarbonat neutralisieren (Gasentwicklung!) und dem Abwasser zuführen.
Erklärung
Video
Literatur
Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)
Werbung
Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.
Rauchende Socken
Dass es im Labor schnell mal unter dem Abzug raucht ist fast normal - und dass einem in der Chemie der Kopf raucht, kommt auch öfters vor. Aber rauchende Socken, die gibt es doch eigentlich nur nach einer Wanderung? Wir lassen das folgende Experiment für sich sprechen:
Allgemeine Hinweise zum Experimentieren und Disclaimer beachten!
Einleitung
Dass es im Labor schnell mal unter dem Abzug raucht ist fast normal - und dass einem in der Chemie der Kopf raucht, kommt auch öfters vor. Aber rauchende Socken, die gibt es doch eigentlich nur nach einer Wanderung? Wir lassen das folgende Experiment für sich sprechen:
Schwierigkeitsgrad
Demonstrationsexperiment - einfach
Geräte
2x 250 mL Bechergläser, säurefeste Handschuhe, Socken
Chemikalien
konz. Salzsäure
konz. Salmiakgeist
Hinweis
Durchführung
Ein Becherglas wird bodenbedeckt mit Salzsäure befüllt, das andere mit Salmiakgeist. Unter Verwendung von Handschuhen werden die beiden Socken in die Lösungen getaucht und dann nahe zusammengehalten. Es entsteht ein weißer Rauch.
Entsorgung
Nach dem Neutralisieren gut verdünnt über den Ausguss.
Erklärung
Salzsäure ist die wässrige Lösung eines Gases, nämlich Chlorwasserstoff. Auch Salmiakgeist ist in Wasser gelöstes - gasförmiges - Ammoniak. Beide Lösungen geben bei hoher Konzentration eine nicht unerhebliche Menge dieser Gase an die Luft ab.
Treffen diese aufeinander, reagieren sie und bilden ein Salz: Ammoniumchlorid.
So kann man das bei Neutralisationsreaktionen entstehende Salz beobachten, ohne zuvor – bei der Durchführung in wässriger Lösung – das Wasser verdampfen zu müssen.
Foto
Video
Literatur
Gefährdungsbeurteilung (Gestis-Stoffdatenbank)
Werbung
Diese Anzeige wird von unseren Werbepartnern geschaltet und hilft uns dabei, die Nutzung unserer Website für Sie weiterhin kostenlos zu halten. Durch das Anzeigen dieser Werbung unterstützen Sie direkt unsere Inhalte und ermöglichen es uns, die Kosten für den Betrieb unserer Website zu decken.